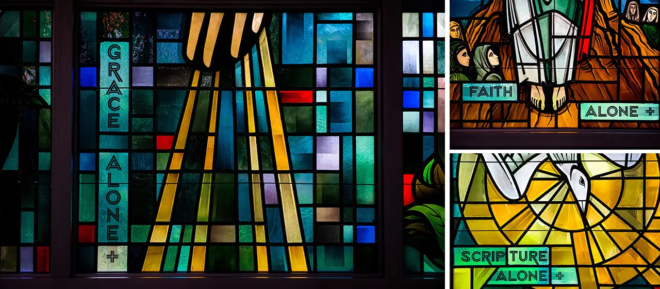
In unserer gegenwärtigen kirchlichen Lage der Auseinandersetzung über die Frauenordination ist es hilfreich, auf das Verständnis und die Auslegung der Heiligen Schrift unserer Schwesterkirche der „Lutheran Church Missouri-Synod“ (LCMS) zu schauen. Die LCMS hatte in den 1970er Jahren auch eine Auseinandersetzung mit theologisch-liberalen Positionen in ihrer Kirche und Hochschule. Aus diesem Anlass beschloss sie 1973 eine Lehrerklärung, aus der Auszüge im Folgenden wiedergegeben werden. Die vollständige Lehrerklärung und eine deutsche Übersetzung befindet sich auf den PDF-Formaten. In der Gesamterklärung befindet sich unter „Das Evangelium und die Heilige Schrift“ u.a. die Feststellung, dass man unter allgemeiner Berufung auf das Evangelium eine Ordination von Frauen nicht begründen und befürwortend entscheiden könne.
Schrift- und bekenntnisgemäße Grundsätze – Eine Lehrerklärung der Missourisynode von 19731
IV. Die Heilige Schrift
Die Inspiration der Heiligen Schrift
Wir glauben, lehren und bekennen, dass alle Schrift durch die Inspiration Gottes, des Heiligen Geistes, gegeben wurde und dass Gott daher der wahre Autor jedes Wortes der Schrift ist. Wir erkennen an, dass es einen qualitativen Unterschied gibt zwischen dem inspirierten Zeugnis der Heiligen Schrift in all ihren Teilen und Worten und dem Zeugnis jeder anderen Form menschlichen Ausdrucks, was die Bibel zu einem einzigartigen Buch macht.
Wir lehnen daher folgende Auffassungen ab:
1. Dass die Heilige Schrift nur in dem Sinne inspiriert ist, dass alle Christen „inspiriert“ sind, die Herrschaft Jesu Christi zu bekennen.
2. Dass der Heilige Geist die eigentlichen Worte der biblischen Autoren nicht inspirierte, sondern diesen Männern lediglich eine besondere Führung gab.
3. Dass nur die Dinge in der Heiligen Schrift vom Heiligen Geist inspiriert sind, die sich direkt auf Jesus Christus und das Heil des Menschen beziehen.
4. Dass nichtkanonische Schriften in der christlichen Tradition im gleichen Sinne wie die Heilige Schrift als „inspiriert“ angesehen werden können.
5. Dass Teile des neutestamentlichen Zeugnisses für Jesus Christus phantasievolle Zusätze enthalten, die ihren Ursprung in der frühchristlichen Gemeinde haben und keine wirklichen Tatsachen darstellen.
Der Zweck der Heiligen Schrift
Wir glauben, dass die ganze Schrift Zeugnis von Jesus Christus ablegt und dass ihr Hauptzweck darin besteht, die Menschen weise zu machen und durch den Glauben an Jesus Christus zur Errettung zu führen. Wir bekräftigen daher, dass die Heilige Schrift nur dann richtig gebraucht wird, wenn sie unter dem Gesichtspunkt der Rechtfertigung durch den Glauben und der richtigen Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium gelesen wird.
Da das Heilswerk Jesu Christi durch seinen persönlichen Eintritt in unsere Geschichte und durch sein wahrhaft geschichtliches Leben, seinen Tod und seine Auferstehung vollbracht wurde, erkennen wir an, dass uns die Anerkennung des soteriologischen Zwecks der Schrift in keiner Weise erlaubt, die Historizität oder Faktizität der in der Bibel überlieferten Dinge in Frage zu stellen oder zu leugnen.
Wir lehnen daher folgende Auffassungen ab:
1. Dass die [bloße] Kenntnis der in der Schrift dargelegten Fakten und Daten, – ohne sie mit Jesus Christus und seinem Erlösungswerk in Beziehung zu setzen –, einen angemessenen Zugang zur Heilige Schrift darstellt.2
2. Dass das Alte Testament, wenn es unter seinen eigenen Bedingungen gelesen wird, kein Zeugnis von Jesus Christus ablegt.
3. Dass es zulässig ist, die Historizität der Ereignisse oder das Geschehen von Wundern, die in der Schrift aufgezeichnet sind, zu verwerfen, solange dies nicht auf eine Verwechslung von Gesetz und Evangelium hinausläuft.
4. Dass die Anerkennung dieses Hauptzwecks der Schrift davon befreit, die Fragen nach folgenden Tatsachen zu bejahen: Waren Adam und Eva reale historische Individuen? Durchquerte Israel das Rote Meer auf dem Trockenen? Hat das Wunder der ehernen Schlange tatsächlich stattgefunden? Wurde Jesus wirklich von einer Jungfrau geboren? Hat Jesus all die Wunder vollbracht, die ihm zugeschrieben werden? Bedeutete die Auferstehung Jesu tatsächlich die Rückkehr seines toten Körpers ins Leben?
Die Unfehlbarkeit der Schrift
Mit Luther bekennen wir, dass „Gottes Wort nicht irren kann“ (Gr. Kat. IV,57). Wir glauben, lehren und bekennen daher, dass die Heilige Schrift, da sie das Wort Gottes ist, keine Irrtümer und Widersprüche3 enthält, sondern dass sie in all ihren Teilen und Worten die unfehlbare Wahrheit ist. Wir sind der Meinung, dass die Behauptung, die Schrift enthalte Irrtümer, eine Verletzung des „sola scriptura“ ist, denn sie beruht auf der Annahme einer Norm oder eines Kriteriums der Wahrheit, das über der Schrift steht. Wir erkennen an, dass es scheinbare Widersprüche oder Diskrepanzen und Probleme gibt, die sich aus der Unsicherheit über den Originaltext ergeben.4
Wir lehnen die folgenden Ansichten ab:
1. Dass die Schrift sowohl theologische als auch faktische Widersprüche und Irrtümer enthält.
2. Dass die Schrift nur in Dingen irrtumslos ist, die sich direkt auf die Heilsbotschaft des Evangeliums beziehen.
3. Dass die Schrift nur funktional irrtumslos ist, das heißt, dass die Schrift nur in dem Sinne „irrtumslos“ ist, dass sie ihr Ziel erreicht, den Menschen das Evangelium des Heils zu bringen.
4. Dass die biblischen Autoren sich daran gewöhnt hätten, die falschen Vorstellungen ihrer Zeit zu verwenden und als wahr zu wiederholen (z.B. die Behauptung, dass die Aussagen des Paulus über die Rolle der Frau in der Kirche heute nicht mehr bindend seien, weil sie das kulturell bedingte Ergebnis dessen seien, dass der Apostel als Kind seiner Zeit die Ansichten des zeitgenössischen Judentums teilte).
5. Dass Aussagen Jesu und der Schreiber des Neuen Testaments über die menschliche Urheberschaft von Teilen des Alten Testaments oder die Historizität bestimmter Personen und Ereignisse des Alten Testaments nicht als wahr angesehen werden müssen (z.B. die davidische Autorschaft von Psalm 110, die Historizität von Jona oder der Fall von Adam und Eva).
6. Dass nur die Aspekte einer biblischen Aussage als wahr angesehen werden müssen, die mit der angeblichen Absicht des Abschnitts übereinstimmen (z.B. dass die Aussagen des Paulus über Adam und Eva in Römer 5 und 1. Korinther 11 die Historizität von Adam und Eva nicht beweisen, weil dies nicht die spezifische Absicht des Apostels war; oder dass die jungfräuliche Geburt unseres Herrn geleugnet werden kann, weil die Kindheitsberichte bei Matthäus und Lukas nicht die spezifische Absicht haben, über ein biologisches Wunder zu sprechen).
7. Dass Jesus einige der Aussagen oder Taten, die ihm in den Evangelien zugeschrieben werden, nicht gemacht oder vollbracht hat, sondern dass sie in Wirklichkeit von der frühen christlichen Gemeinde oder den Evangelisten erfunden oder geschaffen wurden, um ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden.
8. Dass die biblischen Autoren manchmal Aussagen in den Mund von Menschen legten, die sie in Wirklichkeit nicht gemacht haben (z.B. die Behauptung, der „Deuteronomist“ lege Salomo eine Rede in den Mund, die Salomo nie wirklich gehalten hat), oder dass sie Ereignisse als tatsächlich geschehen erzählen, die in Wirklichkeit nicht stattgefunden haben (z.B. der Sündenfall von Adam und Eva, die Durchquerung des Roten Meeres auf dem Trockenen, die Episode der ehernen Schlange, Jesu Verfluchung des Feigenbaums, die Erfahrungen von Johannes dem Täufer in der Wüste, Jesu Verwandlung von Wasser in Wein, Jesu Wandeln auf dem Wasser oder auch die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten oder die Tatsache seines leeren Grabes).
9. Dass die Verwendung bestimmter „literarischer Formen“ notwendigerweise die Historizität dessen, was beschrieben wird, in Frage stellt (z.B. dass die angebliche Midrasch-Form5 der Kindheitserzählungen in Matthäus und Lukas suggeriert, dass tatsächlich keine Jungfrauengeburt stattgefunden hat, oder dass die literarische Form von Genesis 3 gegen die Historizität des Sündenfalls spricht).
Historische Methoden der Bibelauslegung
Da Gott der Herr der Geschichte ist und sich durch Taten in der Geschichte offenbart hat und in der Person seines Sohnes tatsächlich in die Geschichte des Menschen eingetreten ist, erkennen wir an, dass der geschichtliche Rahmen, in den die Botschaft des Evangeliums in der Schrift eingebettet ist, ein wesentlicher Teil des Wortes ist.
Darüber hinaus erkennen wir an, dass es sich bei den inspirierten Schriften um historische Dokumente handelt, die zu verschiedenen Zeiten, Orten und Umständen geschrieben wurden. Wir glauben daher, dass die Heilige Schrift zur historischen Erforschung einlädt und als historische Dokumente ernst zu nehmen ist. Wir bekräftigen jedoch, dass der christliche Interpret der Heiligen Schrift die Voraussetzungen und Methoden (canones) des weltlichen Historikers nicht unkritisch übernehmen kann, sondern dass er sich in seinem Gebrauch der historischen Techniken von den Voraussetzungen seines Glaubens an den Herrn der Geschichte leiten lassen wird, der sich in der Heiligen Schrift als derjenige offenbart, der unsere Geschichte erschafft, erhält und sogar in sie eintritt, um sie zu seinem Ende zu führen.
Wir lehnen daher folgende Auffassungen ab:
1. Dass die Frage, ob bestimmte in der Schrift geschilderte Ereignisse tatsächlich stattgefunden haben, angesichts des Zwecks und der Funktion der Heiligen Schrift unwichtig ist.
2. Dass Methoden, die auf säkularen und naturalistischen Geschichtsvorstellungen beruhen, wie die folgenden, eine gültige Rolle in der Bibelauslegung spielen können:
- Dass das Universum dem Eingreifen Gottes oder irgendeiner übernatürlichen Kraft verschlossen ist.
- Dass Wunder wann immer möglich in naturalistischen Begriffen erklärt werden müssen.
- Dass das Prinzip der Ökonomie der Wunder uns dazu verleiten könnte, [die Tatsächlichkeit] bestimmter Wunder, von denen in der Schrift berichtet wird, zu leugnen.
- Dass die Lehren der Heiligen Schrift das Ergebnis einer natürlichen Entwicklung oder Evolution von Ideen und Erfahrungen innerhalb Israels und der frühen Kirche sind.
- Dass die Botschaft der Heiligen Schrift adäquat an Gesetzen gemessen werden kann, die ausschließlich aus empirischen Daten und rationalen Beobachtungen abgeleitet sind.
- Dass die Unfähigkeit des Menschen, die Zukunft zu kennen, echte vorausschauende Prophezeiungen unmöglich mache.
3. Dass unser Hauptanliegen bei der Bibelauslegung nicht darin besteht, die Bedeutung der Primärquellen, nämlich der kanonischen Schriften, auf der Grundlage der Quellen selbst zu erklären.
4. Dass, wenn die Anwendung historischer Methoden zu Schlussfolgerungen führt, die von der offensichtlichen Bedeutung des biblischen Textes abweichen, abgeleitete Schlussfolgerungen (subconclusions) akzeptiert werden können, sofern sie die lutherische Sicht auf die Schrift oder Verpflichtung auf das lutherische Bekenntnis nicht verletzen (z.B. die Behauptung, es sei statthaft, die Existenz von Engeln oder eines personhaften Teufels aufgrund literarischer, historischer oder theologischer Überlegungen zu leugnen).
Fußnoten:
- Originaltitel: A Statement of Scriptural and Confessional Principles (1973). ↩︎
- Vgl. Jak 2,19: „Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran; die Teufel glauben’s auch und zittern.“ Diese und alle folgenden Fußnoten sind Erläuterungen des Übersetzers. Das Gleiche gilt für die Textergänzungen in eckigen Klammern. ↩︎
- Im engl. Original: “apparent contradictions”. ↩︎
- Gemeint sind die Textvarianten der biblischen Handschriften. ↩︎
- Midraschim = die Erläuterungen der jüdischen Rabbiner. ↩︎
